Das Geheimnis der Anden II,
Teil 123 der Serie
»Monstermauern, Mumien und Mysterien«
von Walter-Jörg Langbein
Teil 123 der Serie
»Monstermauern, Mumien und Mysterien«
von Walter-Jörg Langbein
Astronauten umkreisen in ihrem Raumschiff einen fremden Planeten. Wo sollen sie landen? Aus der Umlaufbahn führen sie Messungen durch ... und finden einen idealen Landeplatz: auf einem hoch gelegenen Plateau. Hier fahren die Astronauten in ihrem Spaceshuttle hernieder ... und beginnen vorsichtig, die nähere Umgebung ihres Landeplatzes zu erkunden. Immer größere Kreise ziehen sie, immer weiter wagen sie es, sich von ihrem sicheren Vehikel zu entfernen. Und plötzlich stehen sie vor seltsamen Monolithen.
Die Astronauten untersuchen die seltsamen Artefakte. Sie sind glatt poliert, weisen aber auch seltsame, exakt gefräste Vertiefungen auf. Wie alt mögen die Steinsäulen sein? Wochen und Monate vergehen, die fremden Besucher aus dem All erlernen die Sprache der Eingeborenen. So erfahren sie, dass die Urheber der seltsamen Steinmonumente unbekannt sind. »Wir nennen die seltsame Stätte auf dem Hochplateau ›Platz der stehenden Steine‹!« erzählen die Einheimischen. Es sind friedliche Menschen, die in primitiven Hütten hausen. Mit vorsintflutlich wirkenden Gerätschaften bestellen sie das karge Land und trotzen ihm spärliche Ernten ab.
 |
| Das sollen Steinzeitmenschen angefertigt haben ... Foto W-J.Langbein |
So könnte ein Science-Fiction-Film beginnen. Als Kulisse könnte das Hochland von Tiwanaku in den Hochanden Boliviens dienen. Man findet es im nördlichen Südamerika, 4.000 Meter über dem Meeresspiegel, etwa 70 Kilometer westlich von La Paz gelegen. Der Reisende orientiert sich am besten so: Man folge der Hauptstraße von La Paz nach Desaguadero, einem verschlafenen Kleinstädtchen an der Grenze zu Peru.
Die mysteriösen Steinstelen gab und gibt es tatsächlich. Aber wer hat sie so präzise aus dem Fels geschlagen? Wer hat sie auf dem bolivianischen Altiplano aufgestellt? Wer wirkte in 4.000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel? Waren es Baumeister der Aymara? Offen gesagt: Die Steinmetzarbeiten wurden meiner Überzeugung nach nicht vom steinzeitlichen Volk der Aymara geleistet. In der Sprache der Aymara heißt der mysteriöse Platz mit den Steinstelen »Kalasasaya«, verkürzt »Kalasaya«), zu Deutsch »Platz der stehenden Steine«. Diese Bezeichnung macht klar, dass die Aymara auf der mysteriösen Stätte kein beeindruckendes Bauwerk, sondern »nur« stehende Steine vorfanden. Die stehenden Steine waren die Überbleibsel eines monumentalen Bauwerks aus uralten Zeiten.
 |
| Stehende Steine um 1930 Foto: Archiv W-J. Langbein |
 |
| »Rekonstruierte« Mauer Foto: Erich von Däniken |
Nun will ich der Zunft der südamerikanischen Archäologie keineswegs bewusste Täuschung oder gar absichtliche Verfälschung unterstellen. Die Rekonstrukteure der Mauer von »Kalasasaya« waren der festen Überzeugung, dass einst ein primitives Steinzeitvolk jenes Mauerwerk aufstockte. Also rekonstruierten sie, also produzierten sie ein Endergebnis, das zu einem »primitiven Steinzeitvolk« passt. Und die erstaunlich präzisen Schnitte und polierten Flächen ... verschwanden unter primitivem Mauerwerk. Und so sind jene Merkmale, die für eine fortgeschrittene Steinmetzkunst sprechen ... dank der »Rekonstruktion« verschwunden.
Prof. Hans Schindler-Bellamy versicherte mir im Gespräch: »Es wäre ehrlicher gewesen, die ›stehenden Steine‹ frei zu lassen! Es gab einst Mauerwerk zwischen den Stützsteinen. Aber das wurde nicht aus roh behauenen Steinblöcken gebildet, sondern aus millimetergenau, präzise und glatt geschliffenen Steinen. Diese Steine passten wie Nut und Feder in die Aussparungen.«
Statt aus millimetergenauer Maßarbeit besteht das Mauerwerk zwischen den Monolithen aus wahllos zusammengesetzten Steinen. Mehrere Arbeiter vor Ort versicherten mir: diese Steine wurden zusammengesucht und dann nach Bedarf angepasst. So entstand eine Mauer, wie sie nach Ansicht der Archäologen ausgesehen haben muss.« Da nur »primitive« Steinzeitmenschen als Verantwortliche in frage kommen dürfen ... musste die Mauer auch entsprechend dieser Vorstellung neu gebaut werden.
Leider ist archäologische Arbeit nicht immer streng wissenschaftlich: und zwar dann nicht, wenn die Rekonstruktion uralter Bauten nach einem vielleicht falschen Bild von der Vergangenheit erfolgt! Vor Ort kommen dem kritischen Beobachter immer wieder Zweifel auf. In welchem Zustand wurden die Ruinen von Tiahuanaco von den Archäologen vorgefunden? Was wurde ergänzt, rekonstruiert? Was ist heute noch »Original«, was ist »Rekonstruktion«? Und kann man sich auf die Rekonstruktionen wirklich verlassen?
Im konkreten Fall hat man eine exakt zugeschnittene, u-förmige »Wasserrinne« wahllos in die Mauer eingesetzt. Wenn das gute Stück tatsächlich dort in der Mauer gesessen haben sollte ... wäre das Regenwasser von außen direkt »in die gute Stube« geleitet worden!
 |
| 1930 und 1990, »Original« und »Rekonstruktion« - Fotos: Archiv W-J.Langbein (oben), Foto W-J.Langbein (unten) |
Damit kein Irrtum entsteht: Ich behaupte keineswegs, dass einst außerirdische Besucher aus dem All die Mauern von »Kalasasaya« bauten. Meiner Überzeugung nach können es aber keine Steinzeitmenschen gewesen sein, sondern Vertreter einer fortgeschrittenen Zivilisation, die über vorzügliche Werkzeuge aus Metall verfügten. Mit Steinzeitwerkzeugen waren die präzisen Bearbeitungen der »stehenden Steine« nicht zu bewerkstelligen!
Was wissen wir über die »stehenden Steine«? Sie markieren den Verlauf einer Mauer, von der wir nicht wissen, wie sie ausgesehen hat. Die vermutlich exakt bearbeiteten und glatt polierten Zwischenwände wurden im Verlauf der Jahrhunderte abtransportiert und verarbeitet. Wie groß war der Platz, den die mysteriöse Mauer einst umrahmte? Auch das weiß man nicht genau. Im Verlauf der Jahrzehnte habe ich unterschiedliche Größenangaben gelesen. Wikipedia vermeldet 129 mal 118 Meter. Edmund Kiss (3) gibt an 135 mal 118 Meter. Im Internet fand ich wieder andere Zahlen: 126,20 mal 117,50 Meter (4).
Es stellt sich die Frage, ob primitives Mauerwerk zwischen den stehenden Steinen tatsächlich die präzisen Säulen zu einer geschlossenen Wand ergänzte. Oder waren die sauber geschnittenen Steine eher als Hilfsmittel zum Peilen gedacht? Die Gesamtanlage jedenfalls ist präzise nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ... und wird als Sonnenobservatorium verstanden. Wieder kommen mir Zweifel: Ein Steinzeitvolk, das keine Schrift kannte, soll präzise astronomische Beobachtungen gemacht haben? Für uns ist es heute selbstverständlich, ein Buch zu lesen, wenn wir uns wissenschaftliche Daten vor Augen führen wollen. Wie aber soll ein Steinzeitvolk ohne Schrift astronomische Daten verewigt haben? Wie soll so ein Volk präzise Bauten errichtet haben, die als Observatorien dienten?
In Eiseskälte, mit mehreren Pullovern übereinander als Wärmeschutz, erkundigte ich das wahre Tiahuanaco: zum Beispiel einen unterirdischen Tunnel, dessen Wände aus millimetergenau aufeinander abgestimmten Steinen bestanden. Im Vergleich dazu muten vermeintliche »Rekonstruktionen« aus unseren Tagen mehr als stümperhaft an!
Fußnoten
1 Däniken, Erich von: »Götterdämmerung«, Rottenburg 2009, S.77 und 78
2 Ich habe mir erlaubt, Erich von Dänikens vorzügliche Farbaufnahme im Kontrast leicht zu verstärken. So wird noch deutlicher, wie vermurkst die Rekonstruktion ausgefallen ist! Siehe: Däniken, Erich von: Däniken, Erich von: »Götterdämmerung«, Rottenburg 2009, S.80 und S.81!
3 Kiss, Edmund: »Das Sonnenthor von Tihuanaku«, Leipzig 1937, S. 42
4 Leider nicht mehr auffindbar.
»Von Toren aus Stein/ Das Geheimnis der Anden III«,
Teil 124 der Serie
»Monstermauern, Mumien und Mysterien«
von Walter-Jörg Langbein,
erscheint am 03.06.2012
Teil 124 der Serie
»Monstermauern, Mumien und Mysterien«
von Walter-Jörg Langbein,
erscheint am 03.06.2012























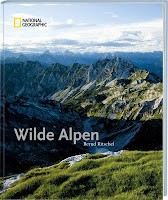






 «.
«. 









